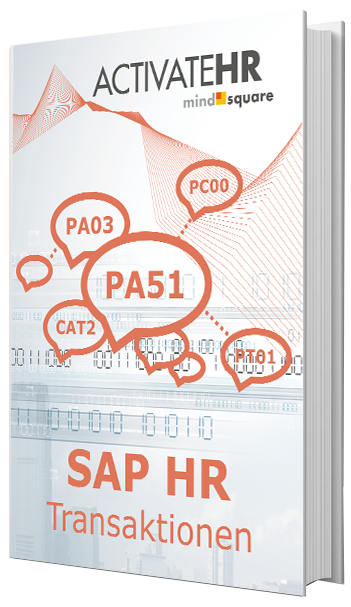Ich habe neulich, meine Damen und Herren, das schlimmste Wort der Welt gelesen. Es lautet: «designig». Damit wurde in einer Möbelprospektbeilage ein Sessel gekennzeichnet. Designig – was soll das heissen? Offenbar dass ein Gegenstand durch eine besondere Form auffällt. «Design» scheint heutzutage eine überaus positiv besetzte Etikette zu sein, unabdingbar, überall, für alles. Dabei bedeutet Design ja zunächst nichts weiter als Gestaltung, Konzept oder eben Formgebung. Darinnen ist noch kein Qualitätsurteil enthalten. Doch der Begriff des Designs hat – wie derjenige der Kunst – seit den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts eine geradezu monströse Ausweitung erlebt, die Verwischung seiner Definitionsgrenzen und die Koexistenz aller möglichen Qualitätsstandards haben dazu geführt, dass Design nun allgegenwärtig scheint: Design wird das, was man dazu erklärt. Ich für meinen Teil wollte erstmal im Duden nachsehen, ob es das Adjektiv «designig» überhaupt gibt. Und was fand ich bei einer kleinen Google-Anfrage? Einen Link zu einer Design-Ausgabe des Duden! Beworben mit der Zeile «Nachschlagen in edlem Design». Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber ich finde: Noch schlimmer als «Design» ist «edles Design». Als ob edel eine Qualität zur kategorialen Behandlung von Design wäre.
Wie aber lässt sich die Qualität von Design heutzutage überhaupt beurteilen? Nun, man könnte zurückgreifen auf das traditionelle Kriterium der Zweckmässigkeit: Design dient der Funktion, die ein Gegenstand zu erfüllen hat. In der Designtheorie wurde dafür der Begriff der Funktionalität geprägt. Nicht zuletzt durch seine Zweckorientierung unterscheidet sich Design von der Kunst. Zweckorientierung hat mit Umwelt zu tun; Design wäre dann als Formgebung quasi ein hermeneutischer Zirkel, der die Werte und Bedürfnisse der Umwelt aufnimmt, worauf wiederum die Umwelt in ihrem Gebrauch der Dingwelt reagiert, im Sinne einer fortwährenden Annährung zwischen Mensch und Ding. Natürlich ändert sich die Stimmung der Umwelt, das ist das, was man Zeitgeist nennt, und deshalb möchte ich im Folgenden einen anderen Weg aufzeigen zur Annäherung an ein Qualitätskriterium für Design: Anstatt einen mutmasslich definitiven Kriterienkatalog zu entwickeln und durchzugehen, will ich ausgehen von der Stimmung unserer Zeit.
Zur Psyche des Hipsters
Dazu nämlich fand sich neulich ein aufschlussreicher und hochkontrovers diskutierter Beitrag in der «New York Times» unter der Überschrift «How To Live Without Irony». Die Autorin, Christy Wampole, Assistenzprofessorin für französische Sprache und Kultur an der Universität Princeton, kritisierte darinnen den urbanen spätmodernen Hipster als Archetypen unserer Epoche – einer Epoche, die sich als ironische versteht. In der materialistischen Ironie der urbanen Mittzwanziger und Mittdreissiger, vielleicht der Hauptstimmung des Digitalen Zeitalters in der Westlichen Welt, erkennt Wampole eine Haltung der Unsicherheit, Resignation, Risikoscheu und kulturellen Taubheit, die das Leben defensiv als endlose Reihe von Sarkasmen und popkulturellen Referenzen zu bewältigen sucht und sich vorzüglich digital, über soziale Netzwerke, darzustellen weiss. Dieser Drang zur Darstellung wird paradoxerweise getragen von der Scheu, sich durch eine eigene Meinung, Position, Festlegung zu exponieren; lieber lässt man sich tragen von der Crowd, am liebsten virtuell: der Schwarm wird zum neuen Referenzpool. Die Furcht vor dem eigenen Standpunkt angesichts einer überwältigend scheinenden Vielzahl an möglichen Positionen und Traditionslinien, angesichts des vagen Gefühls, dass man, konfrontiert mit der Hinterlassenschaft an Meisterleistungen, selbst womöglich wenig Originelles anzubieten hätte, verbindet der Hipster mit einer Nostalgie für Zeiten, die er nie erlebt hat, mit einem obsessiven Studium vermeintlicher sozialer Formen und einer Phobie vor dem, was er (oder sie) für Mainstream hält. Der Hipster scheint nichts ernstzunehmen ausser dem Unernst, er infantilisiert sich selbst, indem er alles als Witz behandelt, seine Lösung für das menschheitsalte Problem der Individualität sind keine Ideen, sondern Dinge. Dabei gehört dem Hipster nichts, was er besitzt: Er macht sich nichts zueigen.
Von diesem Phänotypen ausgehend, stellt Frau Wampole in der «New York Times» fest, dass in der Generation der weissen Mittelklasse zwischen 25 und 35 die Ironie das vorzügliche Mittel der Lebensbewältigung zu sein scheint – eine ewig-provisorische Antwort auf zuviel Komfort, zuviel Geschichte, zuviel Optionen. Ironie äussert sich demnach dominierend in sämtlichen Sphären der Populärkultur: Werbung, Mode, Medien. Dieser ironische Rahmen funktioniert als ein Schild gegen Kritik, eine Abwehr von Verantwortung für Entscheidungen, in ästhetischen wie in allen übrigen Fragen. Die Vorgabe von Distanz, der Kommentar aus der Defensive kommt einer vorauseilenden Kapitulation gleich; er ist eine Form von Ausflucht, Betrug, Trick, Täuschung in einer verunsicherten Welt, der Direktheit unerträglich scheint.
Ironie und Authentizität
Die Kritik von Frau Wampole ist in ihrer Zustandsbeschreibungen sehr fein und kenntnisreich, nur der Grund, auf dem sie steht, ist falsch: der Hipster ist gar nicht ironisch. Oder, genauer: Hipster-Ironie ist Ironie bloss als materialistische Pose, es geht nicht um die subversive und schöpferische Ironie des Talents, sondern die hohle, ängstliche, oberflächliche Distanz des ständigen Zitats um des Zitates willen. Das hat mit echter Ironie nichts zu tun. Wampoles Fehler ist, dass sie die Ironie der Hipster ernst nimmt; die Pseudo-Ironie, deren Emblem der Hipster ist, hat keine Verbindung zum Leben; sie vermittelt nicht zwischen Geist und Leben; sie ist in der Tat das Gegenteil von Authentizität. Diese Pseudo-Ironisierung der Gegenwart ist, wie Frau Wampole zutreffend feststellt, das Zeichen eines (vielfachen) Vakuums, einer Orientierungslosigkeit, auch dem ständigen post-industriellen Zwang zur permanenten Vigilität und Visibilität, dem Information Fatigue Syndrome der digitalen Gesellschaft – und was besorgte Zeitkritiker sonst noch alles diagnostizieren.
Und was hat das mit Design zu tun? Nun, unendlich viel, denn wenn Christy Wampole feststellt, dass nahezu jede Abteilung unserer gegenwärtigen Lebenswirklichkeit einen Zug und Willen zum Ironischen in sich trage und ausstelle, dann ist dies natürlich zuerst und zuvorderst eine Frage des Designs. Wenn Eindeutigkeit, Bestimmtheit und Direktheit unerträglich werden – dann spiegelt sich dies in der Qualität der Dingkultur. Die Dinge verlieren an Echtheit. Und Echtheit, meine Damen und Herren, ist das Kriterium schlechthin zur Erkennung guten Designs – auch wenn manche Leute behaupten, im heutigen Zeitalter des Stilpluralismus scheine es nachgerade unmöglich, eindeutige Kriterien des «guten» oder «schlechten» Designs oder Geschmacks auszumachen. Das stimmt natürlich nicht. Gutes Design ist direkt, jenseits von post-postmodernem Zynismus, Distanzierheit und Meta-Referenzialität. Das heisst: Die Dinge sollen auf sich selbst verweisen. Das heisst: Gutes Design ist essentiell unironisch.
Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits, dass das alte funktionalistische Diktum «form follows function», dass also die Form der Funktion zu folgen habe, nach wie vor gültig ist. Funktionalität ist und bleibt ein Kriterium für gutes, gelungenes Design, und wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, dann geht eine gewisse Anziehungskraft aus von der Idee, dass die in diesem Sinne richtige Form einer Sache gewissermassen notwendig auch deren Schönheit enthalte. Andererseits muss man legitimerweise anerkennen, dass die Funktionen der Dingwelt heute anders aussehen als noch vor 50 oder auch nur 30 Jahren: Die Bezüge der Sachen, die Zeichenfunktionen des Designs, sind vielschichtiger geworden. Für Wolfgang Ullrich, Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, sind die heutigen Konsumgüter komplexe Zeichen- und Kommunikationssysteme, die zu entziffern eine Kulturtechnik ist wie das Lesen von Romanen. Ullrich geht in seinem neuen Buch «Alles nur Konsum» mit dem Untertitel «Kritik der warenästhetischen Erziehung» davon aus, dass seit Beginn der 1990er-Jahre gerade alltägliche Produkte wie Duschgel oder Mineralwasser von einer «Metaphorisierungs- und Inszenierungswelle erfasst und einem Redesign unterzogen» wurden.
Designpraxis und Warenwelt
Diese Sophistizierung der säkularen Warenwelt bietet ganz neue Möglichkeiten für den Bildungsbürger als Konsumbürger, und die zeitgenössische Designpraxis muss vielfältigstes Wissen und disziplinübergreifende Methoden zur Entwicklung von Lösungen und Innovationen nutzen, um in einem komplexen Narrativ eine übergeordnete Syntax zu entwickeln, eine Ordnung, um auf den Menschen zu wirken. Das klingt reichlich abstrakt, und ich will hier auch gar nicht weiter über iterative und kybernetische Designprozesse sprechen, meine Damen und Herren, sondern einfach mal gut 100 Jahre zurückgehen. Im Jahre 1909 eröffnete der Museumsdirektor Gustav E. Pazaurek im Stuttgarter Landesgewerbemuseum seine «Abteilung der Geschmacksverirrungen». Pazaurek entwickelte dafür eine komplexe Systematik zur Einordnung von Gestaltungsfehlern aller Art, um sie am Gegenstand selbst zu entlarven. Entsprechend der Philosophie des Deutschen Werkbunds ging Pazaurek von einem starken Einfluss der Dinge auf den Menschen aus, im ästhetischen wie ethisch-moralischen Sinne. Und eben diese ästhetische Erziehung muss, wenn Sie mich fragen, immer noch zu den Ideale designerischen Handelns gehören. Ich weiss, dass das viele Leute altmodisch finden. Heute, im Zeitalter des Stilpluralismus, scheint Geschmack mehr denn je als soziales Konstrukt durchzugehen, ein relativistisches Phänomen, und jedweder pädagogische Furor in Richtung Geschmacksbildung mutet bestenfalls kurios an. Ich für meinen Teil aber bin sehr wohl der Auffassung, dass man zwischen gut und schlecht gestalteten Dingen unterscheiden kann, und für mich sind schlechte Dinge, post-materialistisch begriffen, vor allem eins: unecht. Falsch, verlogen, unpassend, unglaubwürdig. Allem ästhetischen und ästhetizistischen Relativismus zum Trotz. Unecht ist alles, was gewollt, ideologisiert, botschaftsbeladen ist. Denn immer noch gilt: Kitsch ist vor allem Konvention.
Und ich halte es schliesslich auch entschieden nicht für einen veralteten Anspruch, per Gestaltung die Welt verbessern zu können. Wir müssen nur lernen und wagen, die Dinge wieder ernst zu nehmen. Wahre Ironie nimmt ja auch das Leben ernst, seine Absurdität und Komik, nur deshalb kann sie sich über seine Absurdität erheben. Wahre Ironie, Ironie nicht als modebewusstes Zitat, sondern als Geisteshaltung, als Haltung der nüchternen Distanz und skeptischen Reserve, des kritischen Pragmatismus, hat eine Meinung, genau wie wahres Design. Das brauchen wir: nicht «edles Design» – wahres Design. Der erste Verweis der Dinge sollte immer auf sich selbst sein. Das ist gutes Design.
Der Beitrag Was ist gutes Design? erschien zuerst auf Blog Magazin.